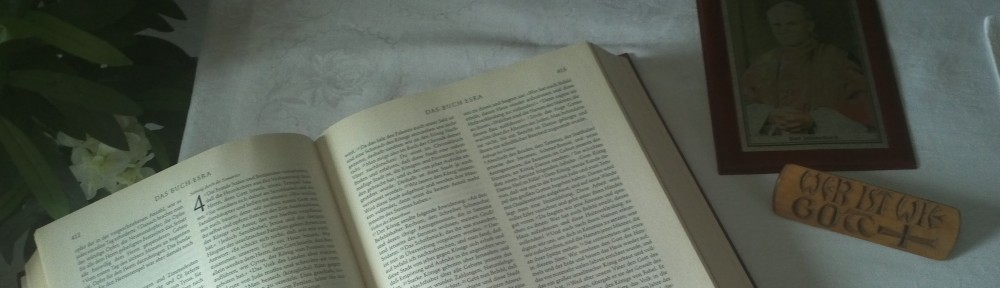Fortsetzung …
Er findet zwei Hauptursachen: Die erste ist, sich von den Leidenschaften, von der Diktatur der eigenen Gelüste, vom Egoismus beherrschen zu lassen (vgl. Jak 4,1–2a); die zweite ist das fehlende Gebet – »weil ihr nicht bittet« (Jak 4,2b) – oder das Vorhandensein eines Gebets, das nicht als solches bezeichnet werden kann: »Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden« (Jak 4,3). Dem hl. Jakobus zufolge würde diese Situation sich ändern, wenn die ganze Gemeinschaft gemeinsam mit Gott sprechen, inständig und einmütig beten würde. Denn auch das Reden über Gott läuft Gefahr, seine innere Kraft zu verlieren, und das Zeugnis wird schal, wenn sie nicht vom Gebet, von der Kontinuität eines lebendigen Gesprächs mit dem Herrn beseelt, getragen und begleitet werden.
Das ist ein wichtiger Hinweis auch für uns und unsere Gemeinschaften, für die kleinen – wie die Familie – ebenso wie für die größeren, wie die Pfarrei, die Diözese, die ganze Kirche. Und es macht mich nachdenklich, dass in dieser Gemeinde des hl. Jakobus gebetet wurde, aber in böser Absicht gebetet wurde, nur für die eigene Leidenschaft. Wir müssen immer wieder lernen, gut zu beten, wahrhaftig zu beten, sich auf Gott und nicht auf das eigene Wohl auszurichten. Die Gemeinde dagegen, die die Gefangenschaft des Petrus begleitet, ist eine Gemeinde, die wirklich betet, die ganze Nacht, vereint. Und eine unermessliche Freude erfüllt das Herz aller, als der Apostel unerwartet an das Tor klopft. Es ist die Freude und das Staunen über das Wirken Gottes, der sie erhört. So steigt das Gebet für Petrus von der Kirche auf, und er kehrt in die Kirche zurück, um zu berichten, »wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte« (Apg 12,17). In jener Kirche, in der er als Fels eingesetzt ist (vgl. Mt 16,18), berichtet Petrus von seinem »Pascha« der Befreiung: Er erfährt, dass in der Nachfolge Christi die wahre Freiheit liegt, man vom strahlenden Licht der Auferstehung umgeben ist, und daher kann er bis zum Martyrium bezeugen, dass der Herr auferstanden ist und wahrhaftig »seinen Engel gesandt hat und mich der Hand des Herodes entrissen hat« (Apg 12,11). Das Martyrium, das er später in Rom erleiden wird, wird ihn endgültig mit Christus vereinen, der zu ihm gesagt hatte: Wenn du alt geworden bist, wird ein anderer dich führen, wohin du nicht willst – um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde (vgl. Joh 21,18–19).
Fortsetzung folgt …
(Papst Benedikt XVI. bei der Generalaudienz am 09. Mai 2012)