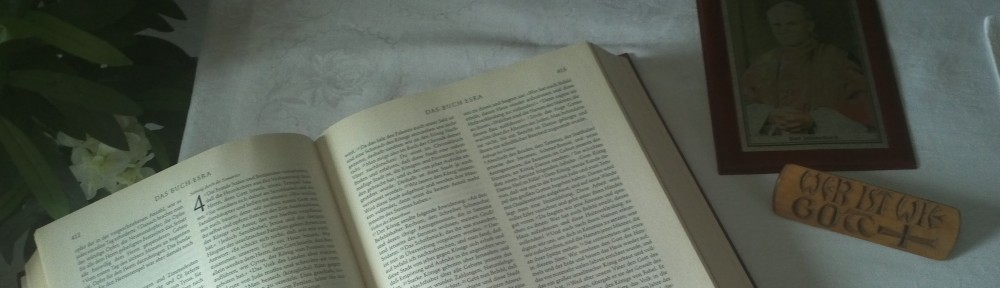„Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus.“
„Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus.“
(Oration aus der Laudes an Erscheinung des Herrn)
05-Januar
 Ernest Hello schrieb in dem Buch „der Mensch“:
Ernest Hello schrieb in dem Buch „der Mensch“:
„Es lässt sich gar nicht sagen, welch ungeheuere Bedeutung die Sprache hat. Worte sind Brot oder Gift, und die allgemeine Verwirrung ist eines der Kennzeichen unserer Zeit …“
(Aus dem Lektionar. Mehr gibt es hier.)
04-Januar
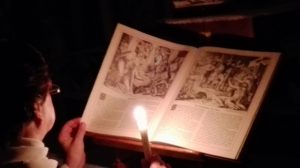 „Allmächtiger Gott, zu unserem Heil ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen. Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, damit sich unser Leben von Tag zu Tag erneuert. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.“
„Allmächtiger Gott, zu unserem Heil ist dein Sohn als Licht der Welt erschienen. Lass dieses Licht in unseren Herzen aufstrahlen, damit sich unser Leben von Tag zu Tag erneuert. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.“
(Oration aus dem Lektionar vom 04. Januar)
03. Januar
Tags darauf sah er (Johannes) Jesus auf sich zukommen und sprach: »Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt! Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der mir voraus ist, weil er eher war als ich. Ich kannte ihn nicht; doch dass er Israel offenbar werde, dazu kam ich und taufe mit Wasser.«
Und Johannes bezeugte: »Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herniederkommen, und er blieb auf ihm. Ich kannte ihn nicht; doch der mich gesandt hat, zu taufen mit Wasser, er sagte mir: Auf wen du den Geist herniederkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der tauft mit Heiligem Geist. Und ich habe gesehen und habe bezeugt: Dieser ist der Sohn Gottes.«
(Johannes 1,29-34)
02. Januar
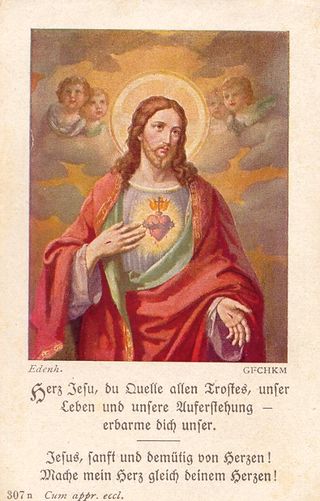
Mein Jesus, in Dein Herz hinein,
da leg ich alle meine Bitten!
Du hast dafür so viele Pein
und gar den bittern Tod erlitten!
Dass Du in Liebe und im Leide
nun würdest meine größte Freude;
drum leg ich in Dein Heilandsherz
all meine Bitten, meinen Schmerz.
2026

Wir wünschen allen ein gesegnetes Neues Jahr 2026!
30. Dezember

„Mir wurde die große Gnade zuteil, unseren Herrn in heiligsten Sakrament zu sehen. Ich sah ihn während meiner ganzen Seminarzeit… ausgenommen an den Tagen, wo ich zweifelte…“.
29. Dezember

Der Heilige Thomas Becket legte die Kanzlerwürde nieder, verteidigte aber unerschrocken die Rechte der Kirche und war fest entschlossen, lieber das Leben zu lassen, als in etwas einzuwilligen, was dem seinem Gott und der Kirche geleisteten Eide widerstrebte.
28. Dezember – Fest der Heiligen Familie

Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir
den Glanz der wahren Liebe,
an euch wenden wir uns voll Vertrauen.
Heilige Familie von Nazareth,
mache auch unsere Familien
zu Orten innigen Miteinanders
und zu Gemeinschaften des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen.
Heilige Familie von Nazareth,
nie mehr gebe es in unseren Familien Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung; wer Verletzung erfahren
oder Anstoß nehmen musste,
finde bald Trost und Heilung.
Heilige Familie von Nazareth,
lass allen bewusst werden,
wie heilig und unantastbar die Familie ist
und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes.
Jesus, Maria und Josef,
hört und erhört unser Flehen.
Amen.
27. Dezember

Heute begeht die Kirche das Fest des heiligen Johannes.